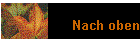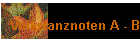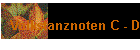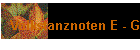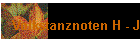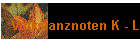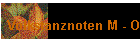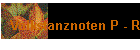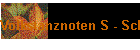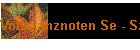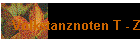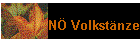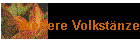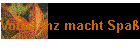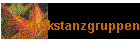Paschen bedeutet rhythmisch in die Hände klatschen. Die Handflächen werden steif gehalten und kurz und hart aneinander geschlagen, man klatscht mit der rechten flachen Hand in die etwa in Brusthöhe ruhig hochgehaltene linke Hand, so dass ein heller, lauter, sehr rhythmischer Klang entsteht. Um richtig, das heißt rhythmisch paschen zu können, sollte man den vollständigen Rhythmus vielleicht im ganzen Körper spüren, miterleben. Man pascht nicht nur mit den Händen, sondern mit dem ganzen Körper.
Gepascht wird im ganzen Alpenland zum Landlertanz. Im Salzkammergut hat sich das Paschen zu großer Kunstfertigkeit entwickelt. Üblicherweise treten bei gewissen Tänzen die Tänzer zur Mitte und singen ein Gstanzl, anschließend paschen sie. Aber auch außerhalb der Tanzunterhaltung wird gepascht, wenn gesungen wird und ein Instrument eine Steirer- oder Landlermelodie aufspielt. Üblicherweise wird zu Harmonikabegleitung gepascht. Ist keine Harmonika verfügbar, wird selten auch trocken gepascht, also ohne Musik, aber immer nach einem gesungenen Gstanzl. Beim Tanz paschen in der Überlieferung ausschließlich die Burschen, im Gasthaus oder bei sonstigen Geselligkeiten paschen auch die Mädchen.
Das Ganze ist polyrhythmisch, jeder pascht seinen eigenen Rhythmus: der (oder die) Vorpascher klatscht den Grundrhythmus, der Zuahipascher klatscht die Synkopen dazwischen, Sechsterer drittern, sie klatschen meist synkopierend, insgesamt alle sechs Achteln des Dreiertaktes. Im Zweiertakt heißt dies manchmal auch Achterer, da der Zweiertakt aus acht Sechzehnteln besteht.
Gepascht wird im Salzkammergut immer anschließend an ein gesungenes
Gstanzl,
üblicherweise durch 8 Takte, meist dreimal hintereinander.
Ruft der Vortänzer "Hüah", so wird weitere 8 Takte, also doppelt so
lange gepascht.
Ruft der Vortänzer dagegen "Hohl", so wird zuerst 8 Takte mit
gewölbten Handflächen gepascht, so dass ein dumpfer Klang entsteht. Dann
folgen wieder 8 Takte "hell", also mit flachen Händen, möglichst
laut.
Dann wird der Tanz wieder fortgesetzt.
Wollen Sie diese Art Paschen erlernen, vom Salzburger Volksliedwerk und von anderen Institutionen im Alpenland gibt es immer wieder Seminare, bei denen auch Paschen unterrichtet wird.
In Wikipedia gibt es beim Stichwort Gstanzl ein Kapitel über das Paschen mit einigen interessanten Beiträgen.
Und hier habe ich ein Video aus dem Jahr 1975 eingefügt, in dem Sie zusehen und zuhören können, wie beim Ausseer Steirer gepascht wird.
Aus Aussee erhielt ich auch folgende Ratschläge zum Paschen:
-
Armbanduhren runter tun, weil die hin werden, oder die Uhrband-Verschlüsse gehen auf und die Uhren fliegen davon.
-
Die zarten Bürohengst- und Musikanten-Handerln gut einschmieren, damit die Haut nicht aufspringt, wenn man länger "pröbelt".
-
Wenn die anfangs zarten Handflächen einmal "gegerbt" sind, klingt’s dann auch "erwachsener".
Auszug aus der Dissertation von Edith Krautgartner (1986)
Da die erste Transkription des "Paschens" 1891 von Josef Pommer in Fuschl am Fuschlsee erstellt wurde und nach Aussagen der Gewährsleute im Ausseerland bereits in den 1880-er Jahren gesechstert wurde, ist anzunehmen, dass zumindest ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in der heute üblichen polyrhythmischen Form gepascht wurde.
Im Ausseerland wurde und wird auch heute noch Wert auf ein polyphones, eines sich aus mehreren Stimmen vertikal zusammensetzendes Klangbild gelegt. Neben den Vorpaschern, die das Grundmetrum schlagen, und dem Zuahipascher, der im Ausseerland zwar variieren kann, aber meistens seinen typischen Schlag ausführt, sollen an einem Pasch noch ein bis drei Sechsterer (Dritterer oder Achterer) beteiligt sein. So liegt der Reiz dieser Paschart in der nuancierten Betonung der einzelnen Achtel (beim Steirer) bzw. Sechzehntel (beim Landler), die durch die Ausführung mit verteilten Rollen entstehen.
Im oberösterreichischen Teil des Salzkammergutes und am Abersee wurde bis zum 2. Weltkrieg eine heterophone "Melodie", angestrebt. Hierbei schlagen die Vorpascher das Grundmetrum, während der Doppler (Zuahipascher), der zwischen die Schläge der Vorpascher pascht, durch Setzen der Pausen ein "Melodie" gestaltet, die er in jedem Paschgsetzl variiert.
Seit dem 2. Weltkrieg werden im oberösterreichischen und salzburgischen Teil des Salzkammergutes zum Vorpaschen und Doppeln auch Dritterer- oder Sechsterer-Schläge angebracht, die nach Aussagen der Gewährsleute vom Ausseerland übernommen wurden.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Beliebtheit und die Häufigkeit des Paschens im Zunehmen ist, was sich darin zeigt, dass heute gerne auch zu Tänzen wie Polka, Marsch, Walzer und Schottisch, zu denen beim Tanz nicht gepascht wird, im Wirtshaus, in der Schützenstube oder bei privaten Zusammenkünften gepascht wird.
Quelle
Edith Krautgartner; Das Paschen im Salzkammergut. Regional - Individualstil. Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1986
Für die Gestaltung meiner Seite stand mir nur ein Auszug dieser Dissertation zur Verfügung. Die gesamte Dissertation wurde von Herman Haertel mit Bewilligung von Dr. Edith Winkler vormals Krautgartner im Dezember 2021 digitalisiert und ist jetzt in voller Länge online abrufbar bei: TRADMUS.org Online-Editionen.
Vom Paschen im Salzkammergut (1930)
In der Zeitschrift Das Deutsche Volkslied hat Max Haager im Jahr 1930 eine Artikelserie verfasst, die im Internet abrufbar ist.
Näheres zum Paschen mit einigen Video-Beispielen auch auf der Seite Mein Österreich - Paschen.
Arbeitsteilige Rhythmen
Beim Paschen teilen sich die Mitwirkenden einen gemeinsamen Rhythmus auf, erzeugen dadurch ein polyrhythmisches Klangbild. Derartige arbeitsteilige Rhythmen gibt es nicht nur im Salzkammergut, sondern auch wo anders auf der Welt, etwa bei der Gamelanmusik in Indonesien, in Java und Bali. Die Ähnlichkeiten der Schlagmuster sind auffallend, besonders beim Drittern im Salzkammergut ist es genau der gleiche Rhythmus.
Angeblich kommt der Name Drittern für die Sechsterer auch vom zu dritt Dreschen, mit dem Dreschschlegel die Getreidekörner vom Stroh lösen. Das gibt es nicht nur im Salzkammergut, diesen Dreschrhythmus gibt es auch in anderen Regionen in ganz Europa.
Dazu gibt es einen Artikel in der Zeitschrift Zwiefach, Ausgabe 2-2018, Seite 19 ff, unter dem Titel: Vertrackt verzahnt - über arbeitsteilige Musik von nah und fern.
Anschließend versuche ich, einige Paschvarianten darzustellen:
|
| |||||
|
Ischler Landler (Bad Ischl) bzw. Aberseer Landler (Zinkenbach am Abersee) | |||||
Landler aus Dietmanns (NÖ Waldviertel) | |||||
Lembacher Landler (NÖ Waldviertel) | |||||
Waldviertler Landler (Großschönau) | |||||
Polka- oder Zwiefachpasch (Ausseerland) |
![]()
A: Steirer Pasch mit drei Sechsterern
Steyrischer (Gößl, Grundlsee, Bad Aussee, Altaussee) Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Michael Kühlental, Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes, Band 25, Wien 1976
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | |
1 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 3 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 3 | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Steirer Pasch mit drei Sechsterern
Ausseer Land, Brucknwirtpasch
Quelle: Edith Krautgartner; Das Paschen im Salzkammergut. Regional - Individualstil. Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1986
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2: Steirer Pasch mit zwei Sechsterern
Ausseer Land
Quelle: Edith Krautgartner; Das Paschen im Salzkammergut. Regional - Individualstil. Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1986
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: Steirer Pasch mit zwei Sechsterern
Ausseer Land
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: Waldhansl, 16 Takte mit drei Sechsterern
Ausseer Land: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Edith Krautgartner; Das Paschen im Salzkammergut. Regional - Individualstil. Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1986
| Takt-Nummer | 15 (Auftakt) | 16 (Auftakt) | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 8. Takt | 9. Takt | 10. Takt | 11. Takt | 12. Takt | 13. Takt | 14. Takt | 15. Takt | 16. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldhansl, Takt 16 bis 32, mit Hüah
| Takt-Nummer | 16 (Übergang) | 17. Takt | 18. Takt | 19. Takt | 20. Takt | 21. Takt | 22. Takt | 23. Takt | 24. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
|
|
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 25. Takt | 26. Takt | 27. Takt | 28. Takt | 29. Takt | 30. Takt | 31. Takt | 32. Takt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sechsterer | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sechsterer | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sechsterer | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1: Waldhansl, 16 Takte laut Fritz Frank
Ausseer Land: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
| Takt-Nummer | 15 (Auftakt) | 16 (Auftakt) | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 8. Takt | 9. Takt | 10. Takt | 11. Takt | 12. Takt | 13. Takt | 14. Takt | 15. Takt | 16. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldhansl, Takt 16 bis 32, mit Hüah
| Takt-Nummer | 16 (Übergang) | 17. Takt | 18. Takt | 19. Takt | 20. Takt | 21. Takt | 22. Takt | 23. Takt | 24. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
|
|
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 25. Takt | 26. Takt | 27. Takt | 28. Takt | 29. Takt | 30. Takt | 31. Takt | 32. Takt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchmal wird zur Waldhansl-Melodie auch nur gesungen und gepascht, ohne dazwischen zu tanzen.
B2: Der Altausseer, 16 Takte mit einem Zuahipascher
Bad Ischl: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 9. Takt | 10. Takt | 11. Takt | 12. Takt | 13. Takt | 14. Takt | 15. Takt | 16. Takt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Zuchipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
B3: Video
Im Steirischen Volksliedwerk gibt es eine etwas vereinfachte moderne Anleitung zum Paschen.
C. Landler Pasch mit einem Sechsterer (Achterer)
Ausseer Landler, 8-taktige Version: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Edith Krautgartner; Das Paschen im Salzkammergut. Regional - Individualstil. Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1986
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-taktig auf Hüah, 8 Takte Normal, 8 Takte mit Absetzen, 8 Takte Normal:
| Takt-Nummer | Auftakt | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt-Nummer | 9. Takt | 10. Takt | 11. Takt | 12. Takt | 13. Takt | 14. Takt | 15. Takt | 16. Takt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 2 | 3 | |
|
1 | |
2 | |
3 | |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sechsterer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Abschluss folgt sofort die oben unter 8-taktig beschriebene Version
D: Ischler Landler
Ischl, Oberösterreichisches Salzkammergut: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Ilka Peter, Tänze aus Österreich, Verlag Ludwig Doblinger, 1946
D1: Aberseer Landler
Zinkenbach am Abersee, salzburger Salzkammergut: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Ilka Peter, Salzburger Tänze, Verlag Alfred Winter, 1988
8-taktige Version
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 


Zuhipascher + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 Dritterer 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 1 dobeln 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 Dritterer sind nur wenige, das "dobeln" (auf alle Achtel klatschen) macht höchstens einer in einer Gruppe.
16- bzw. 24-taktige Version (durchpaschen) wie die 8-taktige Version, jedoch wird im 8. bzw. 16. Takt im gleichen Rhythmus weitergepascht.
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


1 
2 
3 


Zuhipascher + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dritterer 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + 2 3 + + Hier wird das erste Mal hell geklatscht, das zweite Mal hohl, als Abschluss folgt sofort die oben unter 8-taktig beschriebene Version
D2: Mondseer Landler
Mondsee, oberösterreichisches Salzkammergut: Tanzbeschreibung
Quelle: Hermann Derschmidt, Tänze aus Österreich
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 


Zuwipascher + + + + + + + + + + + + + + + Zuhipascher sind nur wenige.
E: Aberseer Schleuniger
Zinkenbach am Abersee, salzburger Salzkammergut: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Quelle: Ilka Peter, Salzburger Tänze, Verlag Alfred Winter, 1988
1. Mal Paschen (8 Takte)
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 


Zuhipascher + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 Meist klatschen alle etwa zur Hälfte als Vorpascher und Zuhipascher, die anderen Paschrhythmen treten erst ab dem 2. Mal Paschen in Aktion
2. Mal Paschen (8 Takte)
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 


Zuhipascher + + + + + + + + + + + + + + + 1 Doppler 1 + + 3 + + + 3 + + + 3 + + + 3 + + + 3 + + + 3 + + + 3 + Doppler 2 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 Dritterer 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Sexterer 1 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + Sexterer 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 Der überwiegende Teil klatscht etwa zur Hälfte als Vorpascher und Zuhipascher, einige wenige klatschen die anderen Rhythmen, es müssen aber nicht alle Rhythmen vertreten sein.
3. Mal Paschen (24 Takte)
8 Takte wie 2. Mal Paschen
dann 8 Takte wie 1. Mal Paschen, jedoch hohl, im 8. Takt wird wie in den vorherigen Takten weiter gepascht
dann weitere 8 Takte wie beim 1. Mal Paschen, jedoch wieder hell und besonders laut.
F: Landler aus Dietmanns
Dietmanns, NÖ Waldviertel: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
8-taktige Version
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vortänzer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

2.Tänzer 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Tänzer 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4. Tänzer 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
G. Lembacher Landler
Lembach bei Zwettl, Niederösterreich: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt Vorpascher 









3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 


Zuahipascher 1 1 + + + + + + + + +
H. Waldviertler Landler
Großschönau, NÖ Waldviertel: Noten - Griffschrift - Tanzbeschreibung
Takt-Nummer 1. Takt 2. Takt 3. Takt 4. Takt 5. Takt 6. Takt 7. Takt 8. Takt alle Tänzer 1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1

2
+ 3 
1 


I. Polkapasch
Ausseer Land, Fischbach
Dies ist eine neue Entwicklung. Zu einer beliebigen schnellen Polka, auch Marsch oder Boarisch/Schottisch, manchmal auch zu Zwiefachen wird in dieser Art zu viert oder zu fünft auf Sechzehntelnoten gepascht.
Zu fünft
| Takt-Nummer | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexterer 1 | 1 | 2+ | 4 | 1+ | 3 | 4+ | 2 | 3+ | 1 | 2+ | 4 | 1+ | 3 | 4+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexterer 2 | 2 | 3+ | 1 | 2+ | 4 | 1+ | 3 | 4+ | 2 | 3+ | 1 | 2+ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexterer 3 | 3 | 4+ | 2 | 3+ | 1 | 2+ | 4 | 1+ | 3 | 4+ | 2 | 3+ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu viert
| Takt-Nummer | 1. Takt | 2. Takt | 3. Takt | 4. Takt | 5. Takt | 6. Takt | 7. Takt | 8. Takt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpascher | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuahipascher | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexterer 1 | 1+ | 3+ | 1+ | 3+ | 1+ | 3+ | 1+ | 3+ | 1+ | 3+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexterer 2 | 2+ | 4+ | 2+ | 4+ | 2+ | 4+ | 2+ | 4+ | 2+ | 4+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paschen im Polkarhythmus, getanzt vom Fischbacher Volkstanzkreis beim Alpenvereinsfest in Wien am 21. 1. 2017
Paschen im Zwiefachrhythmus, zum Zwiefachen "unser alte
Kath" oder Boxhamerisch, getanzt vom Fischbacher Volkstanzkreis beim Alpenvereinsfest in Wien am 21. 1. 2017
![]()